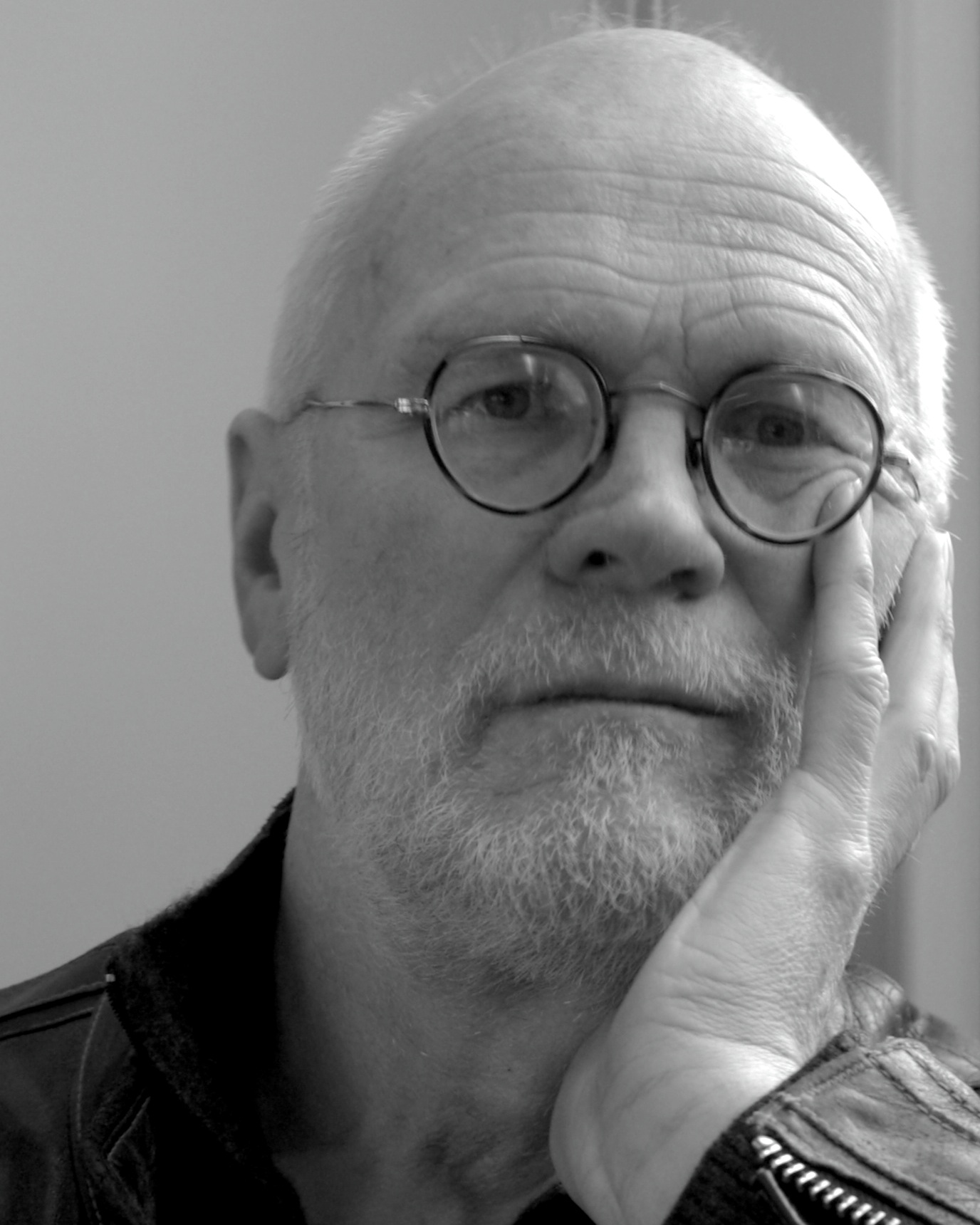 Photo: Maik Bunschkowski
Photo: Maik Bunschkowski
Stand: 27. Oktober 2025
Hinweis
Wer etwas über mich erfahren oder mit mir Verbindung aufnehmen möchte, findet mich nicht bei Facebook. Ich gebe auch weder Meinungen auf Twitter kund, noch beabsichtige ich, dort irgend jemandens Äußerungen zu verfolgen. Vielmehr bin ich mit Heiner Flassbeck einer Meinung, dass ein Verbot dieses Mediums einen entscheidenden Schritt zur Vorbereitung deliberierter politischer Entscheidungen darstellte.
Aber es gibt diese Seite und ich habe auch eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer:
mailto:rainer_fischbach@gmx.net
mobil +49 (0)171 4141570
Haftungsausschluss:
Auf den Inhalt externer Seiten, d. h. Seiten außerhalb meiner Domain, die hier verlinkt sind, habe ich keinen Einfluss und mache mir solchen Inhalt nicht zueigen, sondern distanziere mich explizit davon.
Aktuelles
Gibt es einen KI-Wettlauf?
Der ChatBot R1 der chinesischen Softwareschmiede Deepseek sorgte in den Tagen nach dem 27. Januar 2025 für einige Aufregung — ganz besonders an der Wall Street. Deepseek hatte mit einem Bruchteil der Ressourcen, die US-Unternehmen wie Open AI benötigten, um ihre Large Language Models (LLMs) zu trainieren, das R1 zugrunde liegende erstellt — mit einem Ergebnis, dessen Leistung nicht hinter der der US-Konkurrenz zurückbleibt. Worin besteht dessen Bedeutung? Sind die jetzt oft gehörten Aussagen, dass dies ein fundamentaler Durchbruch sei, der die teuren Spezialprozessoren von Nvidia und anderen überflüssig mache, berechtigt? Hat China damit schon alles erreicht, was westliche Projekte wie StarGate erst vorhaben? Oder sind hinter dem — mit zahlreichen Fehleinschätzungen einhergehenden — Lärm um dieses Ereignis leisere Signale von längerfristiger Bedeutung zu vernehmen?Ich habe dazu einige Überlegungen angestellt [Text als PDF]
[Literaturhinweise zur KI <https://www.rainer-fischbach.info/ki_literatur.html>].
Ein Gespräch zum Thema hatte ich am 7. Februar 2025 in der Sitzung 235 des Coronaausschusses (ab 1:35:00), einen Vortrag zum Thema KI halte ich am 29. Oktober 2025 in der Bibliothek "Heinrich von Kleist", Havemannstr. 17b, 12689 Berlin
[Google Maps, Bus 197, S7 Ahrensfelde, Tram M8, 16 Barnimplatz]
[ Veranstaltungsankündigungen <https://www.berlin.de/bibliotheken-mh/aktuelles/veranstaltungen/live-bei-kleist-und-weltgewandt-e-v-praesentieren-talk-ohne-show-werkzeug-oder-meister-ki-und-der-wandel-von-arbeit-mit-rainer-fischbach-1602868.php>
<https://www.facebook.com/weltgewandt.polis/posts/k%C3%BCnstliche-intelligenz-ist-ein-marketingbegriff-das-sagt-rainer-fischbach-fr%C3%BCher/1258594439640994/>] .
Ein Blick zurück
»Was man wissen konnte«. Manova, 4. Oktober 2024 [Online <https://www.manova.news/artikel/was-man-wissen-konnte/>]Dass man es nicht besser hätte wissen können, das konnte man in letzter Zeit immer wieder hören, wenn es galt, die nicht nur völlig unverhältnismäßigen, sondern auch unwirksamen, wenn nicht gar schädlichen Regierungsmaßnahmen während der sogenannten "Pandemie" zu rechtfertigen. Dass das Robert Koch-Institut (RKI), die dafür zuständige Behörde des Bundesgesundheitsministeriums, es sehr wohl besser wusste, doch, bereitwillig sich den Vorgaben der Regierung fügend, schwieg, ist seit der volltändigen Veröffentlichung der Protokolle des RKI-Krisenstabs durch Aya Velázquez nicht mehr abzustreiten. Doch nicht nur das RKI, sondern wir alle konnten es besser wissen. Aber während nur allzu wenige den Mut fanden und sich die Mühe machten, sich des eigenen Verstandes zu bedienen, um durchaus zugängliche Information zu suchen und auch zu finden, taten sich die akademisch gebildeten Eliten aus Politik, Jounalismus, Erziehungssystem und Wissenschaft größtenteils durch ihr völliges Versagen hervor — ein Sachverhalt, der angesichts anstehender Herausforderungen besonders beunruhigend ist. Der Artikel gibt Hinweise auf einige wesentliche Sachverhalte — zur tatsächlichen Gefährlichkeit und Verbreitung, zur Sinnhaftigkeit von diversen Maßnahmen und, nicht zuletzt, der Eignung einer als "Impfung" getarnten Injektion von genetischem Material zur Eindämmung des Virus—, die man in den Jahren 2020–2022 sehr wohl wissen konnte. Auf einiges davon wies ich schon damals in Beträgen wie »Back to the Basics«, »Indien: COVID- oder Umweltkatastrophe?«, »Woher kommt das SARS-CoV-2? Das Revival der Laborhypothese« und »Pandemie der Eindimensionalität« hin. Ausführlich gibt es das alles in Ein Virus zum Beispiel. Mehr zur Diskussion um die Herkunft des SARS-Cov-2 findet sich in zwei neueren Texten, »"Biowaffe" SARS-CoV-2: Glaubwürdige BND-Enthüllung oder neues Narrativ?« und »Die Brutstätte des Coronavirus«.
Letztes Jahr erschienen (24. Mai 2024)
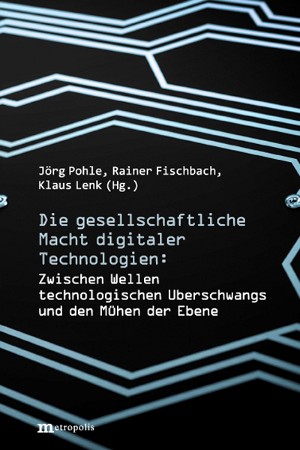 Die gesellschaftliche Macht digitaler Technologien:
Zwischen Wellen technologischen Überschwangs und den Mühen der Ebene.
Die gesellschaftliche Macht digitaler Technologien:
Zwischen Wellen technologischen Überschwangs und den Mühen der Ebene.Herausgegeben von Jörg Pohle, Rainer Fischbach und Klaus Lenk. Marburg: Metropolis, 2024.
299 Seiten, Paperback €29,80, PDF €24,44
ISBN 978-3-7316-1565-1
[Seite zum Buch <https://www.metropolis-verlag.de/Die-gesellschaftliche-Macht-digitaler-Technologien/1565/book.do>]
[Einleitung der Herausgeber <https://www.metropolis-verlag.de/buchbeigaben/1565/1565_einleitung.pdf>]
[Besprechung durch Joachim Hirsch auf Links-Netz]
Neben drei Beiträgen der Herausgeberkollegen und denen von Peter Brödner, Ralf Lankau und Anne Krüger enthält es zwei von mir:
Modellwelten, Weltmodelle und smarte Objekte:
Vor ihrem geschichtlichen Hintergrund, doch bis in die Gegenwart reichend, untersuche ich die Bedeutung von Modellen für das Weltverständnis, die Praxis und nicht zuletzt für die Konstruktion von Softwaresystemen sowie — heute ohne Rechner mit geeigneter Software kaum noch zu machen — von technischen Artefakten, globaler Infrastruktur und davon abhängenden Mensch-Maschine-Systemen. Macht, Definition von und Verfügung über Modelle gehen dabei zusammen.
[Online <https://www.metropolis-verlag.de/Modellwelten%2C-Weltmodelle-und-smarte-Objekte/15336/book.do>]
Von der Atombombe zur Biomacht. Informatik als Treiber globaler Bedrohungen:
Ohne die Atomphysik konnte die Molekularbiologie so wenig entstehen wie die Bomben auf Hiroshima und Nagasaki. Auf den Computer waren die Entwicklung der nachfolgenden Generationen von Atomwaffen mit den Systemen zu ihrer Kontrolle und Beförderung ebenso angewiesen wie die seitherigen Fortschritte der Molekularbiologie. Dass sich mit dieser schon seit ihren Anfängen und bis in die Gegenwart reichend ein Programm der Kontrolle über die menschliche Physis und Psyche wie auch die Gesellschaft verbindet, ist im heutigen Bewusstsein ebenso wenig präsent wie die neuerliche Verschärfung der atomaren Drohung. Ein Versuch, die Zusammenhänge zu verdeutlichen.
[Online <https://www.metropolis-verlag.de/Von-der-Atombombe-zur-Biomacht/15338/book.do>]
40 Jahre War Games
Im Herbst 1983 kam mit War Games ein Streifen in die Kinos, in dem — Premiere solcher Figuren für Hollywood — ein jugendlicher Hacker und ein Atomkrieg spielender Computer die Hauptrollen spielen. Ich hätte das vergessen, wenn ich nicht durch Weltexperiment darauf hingewiesen worden wäre. Ich hatte damals eine Besprechung zu dem Film verfasst, die in Heft 1/1984 der Blätter für deutsche und internationale Politik erschien, die damals noch eine gänzlich andere Zeitschrift waren als heute und auch als Plattform der Friedensbewegung fungierten. Bei erneuter Lektüre erweist sich dieser Text, der den Film in den damaligen nuklearstrategischen Kontext stellt, als überraschend aktuell, nur die vielen Druckfehler verlangen eine Entschuldigung. Den Hintergrund bildete die Diskussion um Atomrüstung und insbesondere die geplante Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland — alles Themen, die wieder brandaktuell sind, ohne entsprechende Auseinandersetzungen oder gar Aktionen auszulösen. Ein weiterer, etwas jüngerer Text, der das Thema (und einige andere) im Kontext der Kybernetik diskutiert ist, wie das Kapitel Von der Atombombe zur Biomacht. Informatik als Treiber globaler Bedrohungen aus dem 2024 erschienenen Band Die gesellschaftliche Macht digitaler Technologien ebenfalls noch aktuell.
Zwei Abschiede
Die drei panisch-pandemischen Jahre und jetzt, noch mehr, der Krieg in der Ukraine, brachten außer immensen Belastungen auch einige Klärungen: nicht zuletzt entblößte sich eine konformistische, weder zur Treue zu ihren Prinzipien noch zum Widerstand gegen die Zumutungen der Gegenwart fähige Linke, der die modischen Gags des victimhood by proxy und des virtue signaling als hinreichender Ausweis progressiver Politik gelten, zur Kenntlichkeit — für mich Grund genug, um zwei Abschiede zu vollziehen:
- Schon im Frühjahr des Jahres 2021 nach nahezu vier Jahrzehnten der Mitgliedschaft von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN/BDA), nachdem mir klar geworden war, das man dort den Kern des historisch fundierten und gegen die Verblendung des Zeitgeistes zu verteidigenden Antifaschismus gegen die Puddingmasse eines zum Nulltarif wohlfeilen Pseudo-Antifaschismus ausgetauscht hatte. Mein Austrittsschreiben mit kleinen sprachlichen Verbesserungen findet sich sich hier.
- Im Herbst des Jahres 2022 vom Wissenschaftlichen Beirat der Rosa Luxemburg-Stiftung, dem ich zwei Jahre lang angehört hatte, während derer sich bei mir zunehmend der Eindruck ingestellt hatte, dass ich dort nicht nur meine Zeit verschwende, sondern auch meinen Namen hergebe für etwas, was ich keinesfalls gutheißen kann. Das Austrittsschreiben findet sich sich hier
Über mich
Publikationen
Die Liste meiner Publikationen findet sich hier. Unter ihnen befinden sich folgende Monographien:
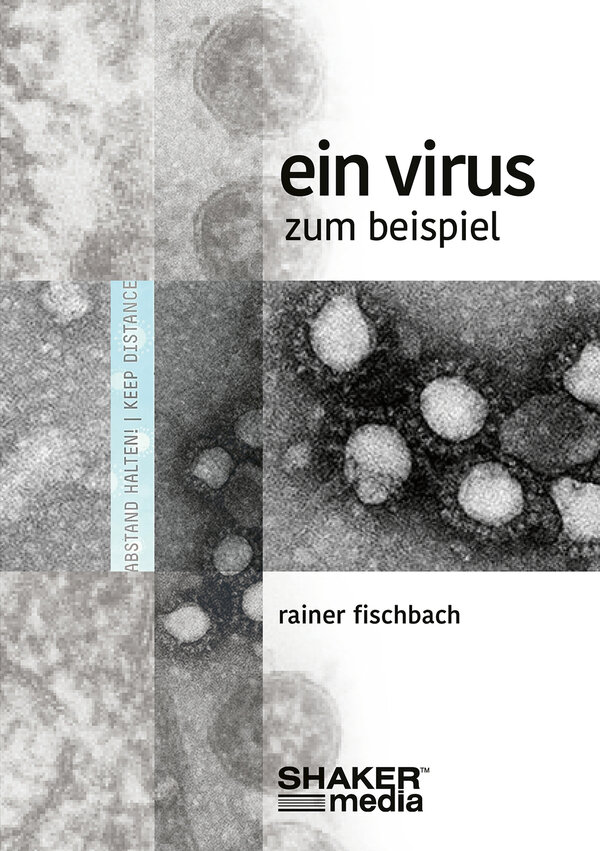 Ein Virus zum Beispiel (2023).
Eine Auseinandersetzung mit der fragwürdigen Politik,
die uns angeblich vor einem Virus schützen sollte.
Ein Virus zum Beispiel (2023).
Eine Auseinandersetzung mit der fragwürdigen Politik,
die uns angeblich vor einem Virus schützen sollte.
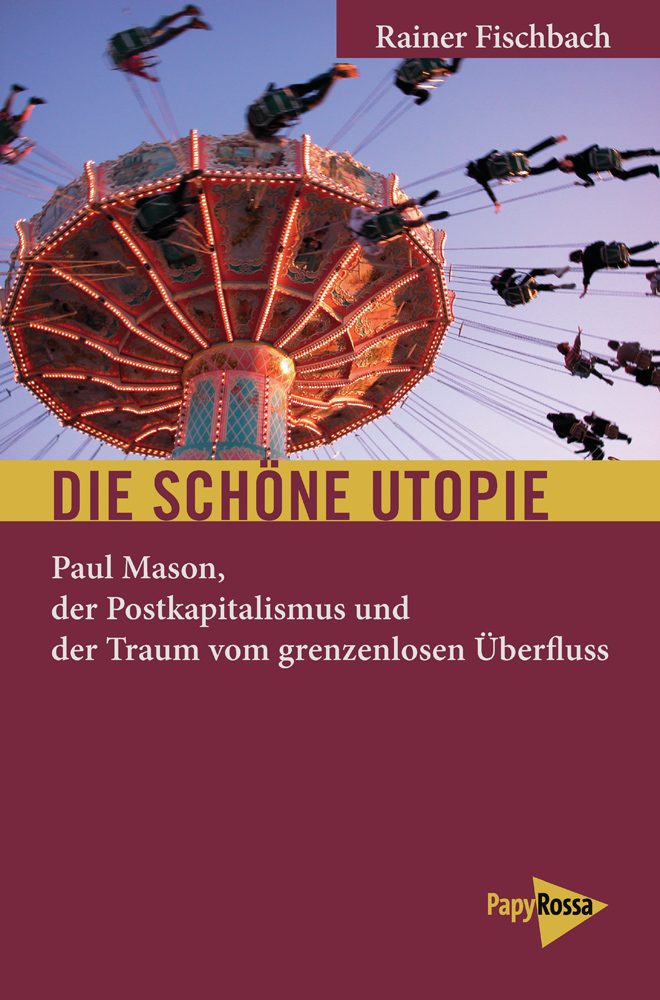 Die schöne Utopie (2017),
eine detaillierte Kritik der unfundierten Erwartungen,
die Paul Mason in einen durch (informations)technische Entwicklung
ermöglichten Postkapitalismus setzt.
Die schöne Utopie (2017),
eine detaillierte Kritik der unfundierten Erwartungen,
die Paul Mason in einen durch (informations)technische Entwicklung
ermöglichten Postkapitalismus setzt.
 Mensch-Natur-Stoffwechsel (2016),
einige Versuche, den menschlichen Stoffwechsel mit der Natur
im Kontext aktueller gesellschaftlicher Verhältnisse
und technischer Möglichkeiten zu diskutieren.
Mensch-Natur-Stoffwechsel (2016),
einige Versuche, den menschlichen Stoffwechsel mit der Natur
im Kontext aktueller gesellschaftlicher Verhältnisse
und technischer Möglichkeiten zu diskutieren.
 Mythos Netz (2005), das, lange vergriffen,
jetzt, nachdem die Rechte wieder in meiner Hand sind,
hier
und
auf Academia
zum Download als PDF bereitsteht.
Mythos Netz (2005), das, lange vergriffen,
jetzt, nachdem die Rechte wieder in meiner Hand sind,
hier
und
auf Academia
zum Download als PDF bereitsteht.
In diesem Buch von 2005 untersuche und relativiere ich
die überschänglichen Erwartungen,
die sich seit den 1990ern mit dem Internet verbinden. In einem
aktuellen Text
werfe ich einen Blick zurück auf meine damaligen Aussagen
und überprüfe, wie sie sich gegenüber den seitherigen
Entwicklungen bewährt haben.
Aktivitäten
Nachdem ich Jahrzehnte an der Konstruktion von Softwaresystemen in diversen industriellen Bereichen gearbeitet, betrieblich sowie als Dozent, Betreuer von Abschlussarbeiten und Mitglied eines Prüfungsausschusses an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg technische Informatiker ausgebildet, schließlich auch Hunderte Vorträge und Aufsätze zu Fachthemen (in Sammelbänden und Zeitschriften, insbesondere in der iX) veröffentlicht habe, beschäftige ich mich jetzt hauptsächlich mit den Themen, die in den letzten Jahren zunehmend meine Aufmerksamkeit fanden: dem Zusammenhang von Wissenschaft, Technik, Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft (in den letzten Jahren vor allem in Beiträgen auf Makroskop). Dabei interessiert mich nicht zuletzt dessen philosophische Dimension.
Mein fachlicher Schwerpunkt lag vor allem auf der Unterstützung von Planung und Produktentwicklung durch IT. Erfahrungen konnte ich in einer Reihe unterschiedlicher Industrien sammeln (Bauwesen, Bergbau, Land- und Baumaschinen, Druckmaschinen, Energietechnik, Automobil- und Bahntechnik). In den letzten zwei Jahrzehnten arbeitete ich vor allem im Umfeld des Product Lifecycle Management (PLM); wobei mein Spezialgebiet die Analyse, Bereinigung bzw. Aufbereitung und Konvertierung großer Datenmengen, insbesondere für die Systemmigration war. Daneben gab es auch andere Aufgaben wie Lösungen für den Upload spezieller Dokumente in PLM-Systeme, z.B. die regelmäße Aktualisierung des Bestands von öffentlichen Normen oder die Übernahme von Entwicklungsdokumenten aus Fremdsystemen, die Generierung von Reports wie unterschiedlichen Formen von Stücklisten oder Unterlagen für das Änderungsmanagement. In meinem letzten Projekt ging es um die Automatisierung von Tests — eine höchst spannende Aufgabe von wachsender Bedeutung. Dazu hatte ich zwar vor Jahrehnten eine Diplomarbeit betreut, doch seither nichts mehr gemacht.
Zu den Themen, die nicht nur immer wieder in meiner Arbeit auftauchten, sondern darüber hinaus mein beständiges Interesse fanden, gehören die technischen und epistemischen Fragen der Modellierung. Ich habe darüber, ursprünglich im Kontext des Bauwesens, schon vor drei Jahrzehnten und mehr gearbeitet und publiziert. Die technischen Probleme der Modellierung motivierten auch mein Interesse an der objektorientierten und funktionalen Programmierung, zu denen ich umfangreich publiziert habe. Die funktionale Technik enthält nach meiner Meinung ein großes Potential für die Verarbeitung großer Datenmengen. In jüngerer Zeit trat jedoch die Beschäftigung mit den epistemischen Fragen in den Vordergrund; was vorläufig seinen Niederschlag einem Konferenzbeitrag fand.